Leseprobe
Ist Sprache ein Instinkt? Eine kritische Diskussion des Pinkerschen Plädoyers für die Instinkthaftigkeit von Sprache am Beispiel seiner Thesen zum kindlichen Erstspracherwerb.
Einleitung
In seinem im Jahre 1994 erschienenen Buch „Der Sprachinstinkt. Wie der Geist die Sprache bildet.“ behandelt Steven Pinker die Sprache des Menschen. Er tut dies nicht im Sinne einer einzelsprachlichen Untersuchung des Englischen, Deutschen oder irgendeiner anderen bestimmten gesprochenen Sprache, und eine Anleitung zu einem grammatisch korrekten Sprachgebrauch ist ebensowenig Erkenntnisgegens- tand seiner Untersuchungen wie etwaige Besonderheiten oder Ursprünge real- sprachlicher Phänomene oder Kuriositäten. Pinker ist es um die Fähigkeit des Men- schen zur Sprache schlechthin zu tun, die er als einen spezifischen Instinkt betrach- tet, der das noch sprachlose Infans determiniert, es mithin ganz ohne dessen oder irgendjemandes anderen Zutun zur Sprache bringt. Er argumentiert somit ganz un- verhohlen gemäß dem Paradigma der kognitivistischen Linguistik, welche die menschliche Sprache auf die Existenz einer genetisch codierten Universalgrammatik zurückzuführen sucht. Die Thesen Steven Pinkers zu diskutieren und zu kritisieren heißt also nolens volens immer auch, sich mit den Annahmen und Prämissen des Modells der kognitiven Sprachwissenschaft auseinanderzusetzen, als dessen Be- gründer und populärster Vertreter Noam Chomsky gelten darf. m ersten Teil der vorliegenden Arbeit sollen deshalb einige auch für Pinkers Argumentation zentrale Thesen dieses Modells der Sprachbetrachtung dargestellt und vor dem Hintergrund des heftigen Wissenschaftsstreites, der sich an ihnen entzündet hat, kritisch hinter- fragt werden. Sodann soll vom Sprachinstinkt selbst die Rede sein, indem die von Pinker vorgenommene Beweisführung zugunsten eines biologisch determinierten und mithin notwendig solipsistischen Erstspracherwerbs im Kontext rezenter Er- kenntnisse und Thesen der Forschung an neuronalen Netzwerken beleuchtet werden soll.
1. Der Sprachinstinkt im Kontext des Chomsky Paradigmas
Schon Aristoteles charakterisiert den Menschen als zwon logon ecwn, als ein Wesen also, das Sprache hat und beschreibt somit die Fähigkeit des Menschen zur Sprache als ein ihn wesenhaft auszeichnendes Vermögen. Es darf als unstrittig gelten, daß der Mensch offenbar über das natürliche Rüstzeug, also eine biologische Grundausstattung verfügen muß, die notwendige Bedingung ist, um Sprache hervorbringen zu können. Alles andere als unstrittig ist jedoch, auf welche Art und Weise sich dies ´Hervorbringen´ von Sprache vollzieht, welche mentalen oder sozialen Prozesse, Organe oder Institutionen auch hinreichende Bedingungen des Spracherwerbs darstellen oder kurz: wer oder was den Infans zur Sprache bringt.
Die kognitive Linguistik, die sich wesentlich an den Thesen Noam Chomskys orien- tiert - und mit ihr auch Steven Pinker - betrachtet Sprache als „mentales Organ, neu- ronales System oder als Berechnungsmodul“1. Pinker selbst bevorzugt den Begriff des „Sprachinstinktes“2, da sich darin die Vorstellung ausdrückt, daß das „Sprach- vermögen des Menschen der Webkunst der Spinne vergleichbar ist“3: So wie die Spinne Netze webt, weil sie ein Spinnengehirn besitzt, so spricht der Mensch, weil er ein Menschengehirn besitzt. Pinker beruft sich mit dieser Charakterisierung - neben Noam Chomsky - auf Charles Darwin, der dem Menschen eine „instinctive Neigung zu sprechen“4 attestierte und wendet sich gegen ´common sense´ Auffassungen von Sprache, denen zufolge diese als kulturelles Artefakt, also als ein Ausdruck mensch- licher Willkür angesehen werden müsse. Der Erkenntnisgegenstand der Sprachwis- senschaft wird somit in den Fokus einer naturwissenschaftlichen Betrachtung ge- rückt, die sich - orientiert am Vorbild der Physik - eines „Galileischen Stils“ befleißigt und also Sprache vermittels „abstrakter Modelle“ zu erforschen sucht.5 Eine solche Konzeption des Sprachbegriffs muß insofern verwirren, als sie der Sprache schlecht- hin eine Triebhaftigkeit - im Falle des Sprachinstinktes - oder einen gleichsam ma- schinellen Automatismus - im Falle des Berechnungsmoduls - zu unterstellen, Spra- che mithin ganz allgemein und auch in solchen Bereichen einem natürlichen Deter- mininismus anheim zu stellen scheint, in denen die meisten Sprecher sich selbst wohl ein gewisses Maß an Willkürlichkeit im Sprachgebrauch attestieren würden: Immer dann nämlich, wenn Sprache als Entäußerungssystem medial und kommuni- kativ wirksam wird. Gerade um diese Bereiche des Begriffspektrums Sprache ist es der kognitiven Sprachwissenschaft jedoch nicht zu tun. Sprache, das heißt im Para- digma der kognitiven Linguistik immer zuerst und vor allem anderen: Grammatik. Nach Ansicht Chomskys gilt es nämlich, „die grundlegende Unterscheidung zwischen der Erzeugung von Sätzen durch die Grammatik einerseits und der Produktion und Interpretation von Sätzen durch den Sprecher andererseits im Auge [zu, der Verf.] behalten.“6 Denn zwar gebe es für die grammatischen Prinzipien ein gewisses Ver- ständnis, nicht aber für den normalen kreativen Sprachgebrauch des Menschen.7 Chomsky trennt also Grammatik8 und Sprache und schränkt den Erkenntnisgegens- tand seiner linguistischen Untersuchung so auf ein Wissenssystem, ein neuronal o- kalisierbares kognitives Vermögen ein:
Wir verlagern „unseren Fokus von der Sprache zu der im Geist/Gehirn repräsen- tierten Grammatik. Die Sprache […] ist, was immer sie auch sei, durch die Regeln der Grammatik charakterisiert […]. Die Grammatik im Geist/Gehirn einer Person ist real; sie ist eines der realen Dinge in der Welt. Die Sprache (was immer das sein mag) ist es nicht.“9
Diese Begriffsabgrenzung macht deutlich, daß Grammatik und Sprache keineswegs - etwa im Interesse einer methodologisch vorteilhaften Zweiteilung des Gattungsbeg- riffs - nur dichotomisch unterschieden werden. Chomsky trennt Grammatik und Sprache kategorial, insofern er der erstgenannten Realität zuspricht und erwartet, daß sie im „genetischen Code bzw. im ausgereiften Gehirn […] physikalisch reprä- sentiert“10 sei. Ihm zufolge ermöglicht erst die Grammatik als organische Grundlage und Ursache Sprache überhaupt, und letztere ist recht eigentlich schon Teil jenes Common-Sense-Verständnisses von Welt11, das der zur Wissenschaftlichkeit hinreichenden Klarheit einer Disziplin bezüglich ihres Erkenntnisgegenstandes eher entgegensteht, als daß es ihr nütze.
Da Chomsky die Grammatik also als Möglichkeitsbedingung für Sprache überhaupt gilt, kann er formulieren: „ Die Sprache ist [..]ein Epiphänomen.“12 und außerdem all ihre funktionalen oder kommunikativen Aspekte, kurz alles sprachliche Handeln aus der Untersuchung ausklammern und in die Peripherie verlagern. Denn er kommt zu dem Schluß, man müsse die „Ansicht verwerfen, daß Kommunikation der Zweck der Sprache ist.“13 Hat diese Prämisse Gültigkeit, so kann das kommunikative Verhalten der Sprecher freilich auch keinerlei Aufschluß über das zugrundeliegende kognitive System vermitteln.
Gemäß dem Chomsky-Paradigma, innerhalb dessen Parametern und Prämissen sich auch Steven Pinker bewegt, ist das ´Hervorbringen´ von Sprache ein Teil des „biologischen Geburtsrechts“ und „nichts, was Eltern ihren Kindern beibringen oder was in der Schule verfeinert werden müßte.“14 Der menschliche Spracherwerb ist vielmehr jenem organischen Grammatik-Programm zu verdanken, das „aus einer endlichen Wortliste eine unendliche Menge von Sätzen erzeugen kann“15. Dies men- tale Regelwerk wird nicht etwa durch sprachliche Interaktion mit der Umwelt erlernt oder wenigstens erweitert. Da Kinder hochkomplexe einzelsprachliche Grammatiken „ohne formale Unterweisung entwickeln und schlüssige Interpretationen für völlig neuartige Satzkonstruktionen liefern können“, müssen Kinder „mit einem angebore- nen Plan ausgestattet sein, der den Grammatiken sämtlicher Sprachen gemeinsam ist - mit einer Universalgrammatik.“16 Diese Universalgrammatik generiert im Verlauf des Heranwachsens gerade die einzelsprachliche Grammatik derjenigen Sprache, unter deren Einfluß das Kind aufwächst. Der Erfahrung, das heißt den sprachlichen und nichtsprachlichen Umwelteinflüssen, denen der werdende Sprecher ausgesetzt ist, kommt dabei eine untergeordnete Rolle zu, da auch das entstehende einzel- sprachliche Regelsystem auf Erfahrung nicht im Sinne einer induktiven Rechtferti- gung gründet, sondern nur insofern, als die Erfahrung die Parameter eines komple- xen Schematismus mit einer Anzahl von Optionen festlegt. Die Funktion der Umwelt bleibt also darauf beschränkt, ein bestimmtes Subprogramm im Programm der Universalgrammatik (UG) auszulösen, das
„mit den Auslöseerfahrungen verträglich ist und mithilfe eines der UG inhärenten Maßstabs höher bewertet wird als andere kognitive Strukturen, die den beiden Be- dingungen der Verträglichkeit mit der UG und mit relevanten Erfahrungen genü- gen.“17
Aus diesen Prämissen des Chomsky-Paradigmas ergeben sich freilich weitreichende Konsequenzen für den Erkenntnisgegenstand der Sprachwissenschaft, da traditionelle und etablierte Domänen der Sprachbetrachtung, etwa Sprachphilosophie und Pragmatik, gleichsam ´weggekürzt´ und in die Randbereiche einer Untersuchung verbannt werden, deren einziges Interesse einer quasi computationalen Satzerzeu- gung durch die Grammatik zu gelten scheint. Es mag daher nicht verwundern, daß die kognitivistische Revolution auf den erbitterten Einspruch vieler Sprachwissen- schaftler gestoßen ist, deren wesentliche Einwände im folgenden Kapitel knapp skiz- ziert werden sollen.18
2 Kognitivistische Sprachwissenschaft und die Erosion ihres Erkenntnisgegens- tandes
Als ein prominenter Kritiker des Chomsky Paradigmas wendet sich Ludwig Jäger ge- gen die von Chomsky behauptete „konzeptuelle Unterscheidung“ zwischen der Sprache als einem bestimmten kognitiven System, also der Grammatik, einerseits und „verschiedenen Prozessierungs - Systemen des mind/brain, die in der einen oder anderen Weise auf das Wissens - System zugreifen und es anwenden“19, also der marginalisierten kommunikativ-medialen Seite des Sprachbegriffs, andererseits. Denn Chomsky konstruiere dergestalt die vorgebliche Opposition einer galileischen, kognitiven Linguistik, die ein wohldefiniertes Konzept von Sprache vorlegen könne gegen eine an Kommunikation orientierte Linguistik, die über ein solches Konzept gerade nicht verfüge, weil sie sich unter Vernachlässigung des ´Galileischen Stils´ von einem vagen alltagssprachlichen Konzept von Sprache leiten lasse. Der Galilei- sche Stil aber gilt Jäger - anders als die Art und Weise seiner Anwendung - als me- thodologisch völlig unstrittig.20 Denn nicht daß „Idealisierungen vorgenommen wer- den müssen, […] ist legitimationsbedürftig, sondern welche.“21 Nach Jägers Ansicht führt Chomskys Konzeption des Sprachbegriffes zu einer Erosion des Erkenntnisge- genstandes Sprache.22 Denn Chomsky habe „eine Auffassung von Sprache entwi- ckelt, in der diese zu einem beinahe vollständig genetisch determinierten, von der Variation kultureller Kontexte und sozial - historischer Randbedingungen weithin un- abhängigen kognitiven Vermögen des Menschen wird.“23 Denn im Rahmen der kognitivistischen Linguistik gibt es
„keinen konstitutiven Zusammenhang zwischen der Struktur, dem kognitiven Sys- tem und seinen funktionalen, z.B. kommunikativen Anwendungen; das heißt auch, es gibt keinen konstitutiven Zusammenhang zwischen der Genese von Subjekt, Geist und Bewußtsein und der Entfaltung zeichenförmiger Entäußerungssysteme wie der Sprache. Das Sprechhandlungssubjekt der Chomsky-Theorien ist ein soli- täres, kognitiv autonomes Gattungssubjekt, das - zu welchem Zweck auch immer - über ein kognitives Teilsystem „Sprache“ (und über andere Teilsysteme) ver- fügt.“24
Eine Sprachwissenschaft aber, die Sprache abgetrennt von den Möglichkeiten ihrer Anwendung betrachten will, beraubt sich Jäger zufolge gleichsam ihrer eignen Grundlage. Denn er betrachtet „Sprache als ein wesentlich auf Kommunikation aus- gerichtetes System“ und darüber hinaus „Subjekt, Geist und Bewußtsein als Entitä- ten, die sich nur über […] Entäußerungshandlungen zu konstituieren vermögen.“25 Somit ist das Sprechhandlungssubjekt nicht solitär, sondern interaktiv und seine kog- nitiven Systeme sind in relevantem Maße Produkte einer zeichenvermittelten Interak- tion.26 Demzufolge kann Sprache ebensowenig vom Sprechen gänzlich losgelöst, wie das Subjekt losgelöst von seinem Sprechen gänzlich bestimmt werden. Zwar ermöglicht das Prinzip der radikalen Arbitrarität seit Ferdinand de Saussure „ein Sprachspiel der Beschreibung von Formen, linguistischer Einheiten, die als solche aus ihrem ´natürlichen´ Medium, der ´verbundenen Rede´, dem Schriftgebrauch wie der alltäglichen Kommunikation, eben der Parole isoliert werden.“27 Doch handelt es sich beim Arbitraritätsprinzip um ein formales Prinzip, das die Form stets als Teil des fait linguistique interpretiert und dergestalt ihre Teilung und gesonderte Untersu- chung methodologisch erst gestattet, da vorausgesetzt werden kann, daß die Form als Teil des signe existiert und also Bedeutung hat.28 Gemäß dem Chomsky- Paradigma aber „wird der Begriff von Grammatik auf eine Weise von dem der Spra- che abgetrennt, die diese einer anderen kategorialen Ordnung zuweist als die Grammatik.“ Das Arbitraritätsgesetz kann mithin für die „Formen der Universalgram- matik […] per definitionem nicht mehr gelten, denn diese <sind> was und wie sie sind, von Natur aus, physei. Die Trennungslinie zwischen Universalgrammatik und faktischer, d.h. auch empirisch erfahrbarer Grammatik, welche im Resultat identisch ist mit der Unterscheidung von <Kern> und <Peripherie> der Grammatik, markiert die Grenze der Domäne des arbitraire du signe.“29 Jene Grenze muß jedoch zugleich auch als Grenze dessen gelten, was noch Sprachwissenschaft genannt werden kann, jenseits „ihrer herrscht reiner Physikalismus.“30 Jäger sieht die kognitivistische Linguistik chomskyscher Provenienz daher gerade aufgrund ihres - zumindest im Anspruch - der Physik verpflichteten Wissenschaftsstils in einem unauflösbaren Wi- derspruch gefangen31.
Denn wenn „wir unter der galileischen Methode nach dem Vorbild der Physik das hypothetische Entwerfen von ´mathematischen Modellen des Universums´ verste- hen sollen, die strengen empirischen Prüfungen unterzogen werden, so ist ´das epistemologische Verfahren´ des Chomsky- Kognitivismus nicht galileisch, weil es (zumindest im physikalisch - naturwissenschaftlichen Sinne) nicht empirisch ist.“32
Der Vorwurf Jägers und Stetters gilt also der Behauptung eines Sprachbegriffs, der zugunsten hypothetischer, genetisch codierter meta-grammatischer Entitäten alle funktionalen und medialen Aspekte der Sprache zur Peripherie erklärt, die Sprache mithin ihrer kommunikativen Anwendungen und das Sprachsubjekt seines sozio- kulturellen Kontextes entkleidet und in cartesianischen Solipsismus verbannt. Ihre methodologische Kritik wendet sich gegen die Forderung der kognitiven Linguistik, den Fokus sprachwissenschaftlicher Betrachtung auf die ausschließliche Untersu- chung jener hypothetischen Entitäten zu verengen, die Universalgrammatik mithin als ´Kern der Sprache` anzusehen. Ein Kern, der doch „erklärtermaßen jenseits aller phänomenal zugänglichen Empirie liegen soll.“33 Stetter sieht das kognitivistische Postulat einer naturwissenschaftlichen Herangehensweise an Sprache mithin im Wi- derspruch zu der Konzeption eines Erkenntnisobjekts, das sich - zumindest bis zum Nachweis der Existenz einer genetisch codierten Grammatik34 - gerade dieser entzieht und konstatiert die „Paradoxie eines empirischen Programms mit gleichsam transzendentalem Anspruch.“35
3. Die Universalität komplexer Sprache als ein Indiz für den Sprachinstinkt
„Die Entdeckung der Universaliät komplexer Sprache erfüllt den Linguisten mit Ehr- furcht und ist ein erster Fingerzeig für die Vermutung, daß die Sprache nicht irgend- eine kulturelle Erfindung, sondern das Produkt eines menschlichen Instinktes ist.“36 Mit diesen Worten eröffnet Steven Pinker eine Beweisführung, an deren Ende die zweifelsfreie Erkenntnis stehen soll, es handle sich bei der menschlichen Sprache um ein instinktives, ein angeborenes und im Erbgut verankertes Vermögen, das we- der erlernt werden könne noch erlernt zu werden brauche, da es - vergleichbar dem Wachstum des Körpers - sich ganz von selbst einstelle. Pinker folgt mit dieser These in den wesentlichen Grundannahmen dem Wissenschaftsparadigma Noam Choms- kys,37 und so mag es kaum verwundern, daß er auch im Rahmen seiner Beweisfüh- rung auf zentrale Argumente der kognitivistischen Linguistik rekurriert.
Als ein erstes gewichtiges Indiz für die Instinkthaftigkeit der Sprache gilt ihm die Uni- versalität komplexer Sprachen. Denn es gibt - so Pinker - zwar Steinzeitgesellschaf- ten, aber keine Steinzeitsprachen.38 „Die einen rechnen, indem sie Knochen einker- ben, und entfachen ihr Kochfeuer, indem sie Stöckchen in Holzklötzen hin und her drehen; andere benutzen Computer und Mikrowellenherde. Für die Sprache gilt die- se Korrelation jedoch nicht.“39 Ganz gleich also auf welchem Niveau der kulturellen oder technologischen Entwicklung sich eine Gesellschaft befindet - so Pinkers Ar- gumentation - es läßt sich offensichtlich weder auf den Grad der Komplexität der jeweils gesprochenen Sprache abbilden noch lassen sich anhand der Sprache Rück- schlüsse auf den nicht sprachgebundenen Entwicklungsstand einer Gesellschaft tref- fen. Dies gilt für nichtindustrialisierte Sprachgemeinschaften wie Eskimos, Hottentot- ten und Yanomami-Indianer ebenso wie für - aus der Warte eines an schriftsprachli- chen Kompetenzen orientierten Hochsprachideals oftmals als einzelsprachliche Depravationen diffamierte - dialektale Variationen etwa des Englischen oder Deut- schen.40 Somit liegt der Schluß nahe, daß es sich um von einander entkoppelte Ent- wicklungen handelt, die kategorial verschiedenen Ordnungen angehören. Pinker fin- det mithin die Opposition von soziokulturell bedingter Entwicklung auf der einen und gattungsbedingtem Wachstum der Sprache auf der anderen Seite bestätigt.
Obschon er es nach eigener Aussage für durchaus sinnvoll befindet, „Sprache als Resultat einer evolutionären Adaption zu betrachten“41, folgt Pinker in seiner Argu- mentation Chomskys These, „daß höhere kognitive Fähigkeiten wie das Sprachver- mögen sich nicht als emergente Ergebnisse spezifischer Selektionsvorgänge hätten entwickeln können“42, da „bei anderen Spezies bedeutsame Analogien zum Sprach- vermögen fehlen“43. Andernfalls sollte er zumindest in Erwägung ziehen, daß die phylogenetische Herausbildung zeichenvermittelter Entäußerungssysteme44 eine notwenige Bedingung der Möglichkeit zur Entwicklung von Gesellschaft überhaupt darstellen könnte.45 Mithin handelte es sich bei der Ausbildung menschlicher Hoch- kulturen ganz notwendig um einen der phylogenetischen Herausbildung von Sprach- fähigkeit zeitlich nachgeordneten Prozeß. So sind etwa Oeser und Seitelberger der Ansicht, daß „die Erwerbung der Sprache als Geburtsstunde des Menschen und ihr Besitz als das entscheidende menschliche Vermögen schlechthin angesehen werden kann.“46 Und auch Monod räumt ein,
„daß zwischen der bevorzugten Entwicklung des Zentralnervensystems und der Evolution der den Menschen auszeichnenden einzigartigen Leistungen eine sehr enge Koppelung bestanden hat, welche die Sprache nicht nur zum Produkt, sondern zu einer der Ausgangsbedingungen dieser Evolution werden ließ.“47
Wie ein auf der Verwendung formaler Symbol- oder Zeichensysteme konstitutiv be- ruhender Vorgang wie das Rechnen, das Pinker als Beispiel wählt, ohne die vor- gängige Beherrschung eines hochgradig elaborierten Systems der symbolischen Repräsentation vonstatten gehen sollte, muß ohnehin Pinkers Geheimnis bleiben. Zumal er mögliche Kriterien für die Nichtkomplexität einer natürlichen Sprache schul- dig bleiben muß.48
Auch Pinker räumt in einem Rekurs auf die Bedenken Hilary Putnams, der zu Recht einwendet, nicht alles, was universal sei, sei auch angeboren49, ein, daß die Univer- salität komplexer Sprachen zu einem Beweis der Instinkthaftigkeit von Sprache nicht hinreicht. Diesen will er anhand des kindlichen Spracherwerbes gleichwohl erbringen.
4. Der kindliche Spracherwerb - ein Beweis für die Instinkthaftigkeit von Sprache?
„Die komplexe Sprache ist universal, weil Kinder sie, von Generation zu Generation, tatsächlich neu erfinden - nicht, weil es nützlich für sie ist, sondern weil sie sich einfach nicht dagegen wehren können.“50 Diese grundlegende These schickt Pinker seiner Beweisführung voraus, die im wesentlichen vier an Beispielen belegte Thesen umfaßt, auf die im Folgenden näher eingegangen werden soll:
1. Die Umwandlung von Pidgin- in Kreolsprachen durch Kinder gilt Pinker als Be- weis, daß die Grammatik einer Sprache „weitgehend das geistige Produkt der Kinder ist und nicht von den Eltern durch komplexen sprachlichen Input verfälscht wird“.51
2. Durch Beispiele aus dem Bereich des Spracherwerbs gehörloser Kinder sucht Pinker aufzuzeigen, „wie ein einzelnes Kind die grammatische Komplexität des von ihm aufgenommenen sprachlichen Inputs von sich aus erweitert.“52
3. Chomskys Argument aus dem defizitären Input soll belegen, daß Sprache nicht erlernt werden kann, und schließlich dienen
4. Beobachtungen an Aphasie-Patienten ihm als Beweis für die modulare Organisa- tion des Geist/Gehirns, innerhalb dessen die Sprache „an einer identifizierbaren Stelle […] verankert“53 sein muß.
Sämtliche von Pinker ausgewählten Beispiele sind durchaus stichhaltig und geben einigen Anlaß zu den von ihm getroffenen Annahmen. Gleichwohl mißlingt der Beweis, da die Pinkerschen Thesen keineswegs als zwingende Schlüsse aus den gewählten Beispielen folgen. In der folgenden Diskussion der vier umrissenen zentralen Thesen Pinkers soll versucht werden, alternative Erklärungsansätze für die gewählten Beispiele anzubieten und diese den Thesen Pinkers gegenüberzustellen, um aufzuzeigen, daß jenen eine induktive Beweiskraft gerade nicht zukommt, sie mithin allenfalls als plausible Annahmen aufzufassen sind.
5. Die Kreolisierung einer Sprache
5.1. Die Umwandlung von Pidgin zu Kreolsprachen
Wenn Angehörige verschiedener Sprachgruppen miteinander kommunizieren müs- sen, um praktische Aufgaben zu bewältigen, aber keine Gelegenheit haben, die Sprache ihrer Kommunikationspartner zu lernen, so entwickeln sie oftmals eine Be- helfssprache, die Pidgin genannt wird. „Pidginsprachen bestehen aus abgehackten Wortketten, die der Sprache der Kolonialherren oder Plantagenbesitzer entlehnt wer- den, [haben] eine sehr freie Wortstellung [..] und [sind] grammatisch wenig struktu- riert“.54 Sie verfügen über keine konsistente Wortstellung, keine Präfixe oder Suffixe, keine Zeitformen oder andere temporale und logische Markierungen.55
Kinder, die von ihren Eltern getrennt und von einem Arbeiter betreut werden, der mit ihnen in der Pidginsprache spricht, sind in der Lage, eine Pidginsprache mit einem Schlag in eine vollwertige komplexe Sprache zu wandeln. Sie schaffen „eine gram- matische Komplexität, wo vorher keine […] war, und entwickeln so eine brandneue, höchst expressive Sprache. Die Sprache, die entsteht, wenn Kinder eine Pidginspra- che zu ihrer Muttersprache machen, wird als Kreolsprache bezeichnet.“56 Kreolspra- chen sind echte Sprachen, mit einer standardisierten Wortstellung und grammati- schen Markierungen, die sich im Pidgin noch nicht finden und nicht der Sprache der Kolonialherren entlehnt wurden.57
Unter Berufung auf Derek Bickerton, der das Phänomen der Kreolisierung einer Sprache zuerst aufzeigte, schließt Pinker, daß Kreolsprachen einen „besonders klaren Einblick in das angeborene grammatische Räderwerk im Gehirn ermöglichen“, da diese „weitgehend das geistige Produkt der Kinder […] und nicht von den Eltern durch einen komplexen sprachlichen Input verfälscht“58 sind. Die Kreolisierung einer Sprache macht also deutlich, daß „Menschen eine komplexe Sprache erschaffen“59 und nicht etwa erlernen und wird mithin von ihm als Beweis für die Eingeborenheit eines universalen grammatischen Regelwerks betrachtet.
5.2. Der kindliche Spracherwerb im Lichte des Konnektionismus
Untersuchungen der Neurowissenschaften an neuronalen Computernetzwerken, die Aspekte der neuronalen Vernetzung des Gehirns simulieren, lassen jedoch auch andere als die von Pinker getroffenen Schlußfolgerungen zu. Im folgenden soll daher ein für die Simulation des kindlichen Spracherwerbs essentieller Typ neuronaler Netzwerke kurz vorgestellt werden.
5.2.1. Spracherwerb an Elman - Netzwerken: Ein Exkurs
Elman - Netzwerke stellen einen vierschichtigen Netzwerktyp60 dar, der zur Repräsen- tation von Zeit in neuronalen Netzwerken in der Lage ist. Das Problem der Repräsen- tation zeitlicher Abfolgen wird dabei durch eine sogenannte Kontextschicht gelöst. Diese Kontextschicht erhält als Input den Aktivierungszustand der Zwischenschicht ohne jede Veränderung, so daß dieser zusammen mit dem nächsten Inputmuster der Zwischenschicht erneut als Input dargeboten wird. Die Zwischenschicht erhält derge- stalt stets zweierlei Input, den jeweils neuen Input und ihren eigenen Zustand beim vorhergegangenen Input. So können sich einzelne Inputmuster auf die Verarbeitung des nachfolgenen Musters auswirken und gleichsam über die Zeit hinweg wirken.
Dergestalt wird die interne Repräsentation des Kontextes von Information möglich:
Denn ein „Wort steht selten für sich allein, sondern ist umgeben von anderen Worten, die seine Verarbeitung bestimmen. Wir fassen beispielsweise das Wort ´Bank´ ganz anders auf, wenn es im Kontext ´Geld, Zinsen, Frankfurt´ auftaucht oder im Kontext ´Stuhl, Park, Tisch´.“61
Die Kontextschicht läßt sich in psychologischer Hinsicht als Arbeitsgedächtnis inter- pretieren. Da Elman-Netzwerke in der Lage sind, komplexe Input-Output-Relationen, „wie sie beispielsweise beim Verstehen von verschachtelten Sätzen auftreten“62 zu erlernen, eignen sie sich besonders für die Simulation des kindlichen Erstspracher- werbs. Um den biologischen Gegebenheiten dieses Vorganges gerecht zu werden, ist es jedoch notwendig, daß das Netzwerk in der Lage ist, auch dann Regelmäßig- keiten aus dem dargebotenen Input herauszufiltern, wenn dieser nicht in lerngerech- ten Häppchen - etwa durch einen Lehrer - dargeboten wird, da Kinder „von Anfang an einer komplexen Sprachumgebung ausgesetzt [sind], die keineswegs auf die Be- dürfnisse einzelner Lernphasen Rücksicht nimmt.“63 Um gleichwohl eine Extraktion von Regelmäßigkeiten auch aus von vornherein komplexem Input zu ermöglichen, wurde die Kapazität der Kontextschicht des Netzwerkes - analog zur sich sukzessive steigernden Kapazität des kindlichen Frontalhirns - zu Beginn stark reduziert und dann langsam gesteigert. „So lernte das Netzwerk komplexe grammatische Struktu- ren. Dies war auch dann der Fall, wenn komplexer Input von Anfang an im Wechsel mit einfachem Input dargeboten wurde.“64 Spitzer erklärt:
Engel/ P. König: Das neurobiologische Wahrnehmungsparadigma[…].- In: P. Gold et. al. (Hg.): Der Mensch in der Perspektive der Kognitionswissenschaften.- Frankfurt/M.: 1998, 156-195.
„Für ein Netzwerk mit noch geringer Kapazität sind komplexe Inputmuster regellos (die Regel wird nicht erkannt bzw. intern abgebildet), sie stellen somit informations- theoretisch gesprochen nichts als Rauschen dar. Für ein solches Netz ist der natürliche sprachliche Input somit ein Gemisch aus regelhaftem (einfachem) Input und für das Netzwerk regellosem (weil komplexem) Input. In diesem Zustand kön- nen […] überhaupt nur einfache Regelhaftigkeiten aus den Inputmustern extrahiert (d.h. gelernt) werden. Sind diese einfachen Regeln jedoch gelernt und findet dann eine Erhöhung der Kapazität des Netzwerkes statt, dann ist es nicht nur […] zur Verarbeitung von komplexem Input fähig, es wird diesen Input vielmehr auch des- halb verarbeiten können, weil die hierin liegende Komplexität bereits als Ausnah- me vom einfachen Fall erkannt werden kann.“65
Die langsame - weitgehend extrauterine - Entwicklung des menschlichen Frontal- hirns erscheint vor der Folie dieser Erkenntnisse in einem völlig neuen Licht. Denn der frontale Kortex ist im Sinne einer Rückkopplungsschleife in die Informationsver- arbeitung anderer Hirnteile so eingebunden, wie die Kontextschicht in einem Elman- Netzwerk:
„Erst im Schulalter sind die verbindenden Fasern vollständig myelinisiert66 und da- mit dieser Hirnteil in die zerebrale Informationsverarbeitung vollständig integriert. Im Hinblick auf die Situation des Spracherwerbs beim Kind bedeutet dies, daß sein bei der Geburt noch nicht vollständig entwickeltes Frontalhirn nicht Hindernis, son- dern Voraussetzung dafür ist, daß es komplexe grammatische Strukturen lernen kann.“67
5.2.2. Die Kreolisierung einer Sprache als Resultat des kortikalen Wachstums
Anhand der an Elman - Netzwerken durchgeführten Untersuchungen läßt sich Spit- zer zufolge auch die Kreolisierung von Pidginsprachen erklären, und dies - anders als von Pinker unterstellt - ganz ohne Rückgriff auf ein angeborenes grammatisches Regelwerk.
Denn „Regeln, z. B. die unserer Sprache, sind nicht im Kopf, d.h. sie werden nicht benutzt, um Sprache zu produzieren. Sie dienen lediglich der nachträglichen Be- schreibung dessen, was wir mittels ganz anderer Prozesse an Sprache produzie- ren und verstehen.“68
Der Schlüssel zum Verständnis der spontanen Ausbildung einer neuen Sprache, wie im Falle der Kreolisierung des Pidgin liegt seiner Ansicht nach in der beschriebenen langsamen Entwicklung des frontalen Kortex. Denn zwar können „Kinder neue Spra- chen gleichsam erfinden […], Erwachsene hingegen nicht.“ Dies geschieht „vor allem durch den subtilen Gebrauch der Pidgin - Sprache“69:
„Wie Wittgenstein in den Logischen Untersuchungen [gemeint sind die „Philosophischen Untersuchungen“, d. Verf.] richtig sagt, ist Sprache immer auch eine Lebensform und schließt das Sich-Verhalten zur Umwelt und insbesondere zu anderen mit ein. Diese Verhaltensmuster sind komplex, auch dann, wenn die Sprachlaute (wie im Falle des Pidgin) einfach sind.“70
Spitzer zufolge sind es also gerade die im Rahmen des kognitivistischen Paradigmas zur Peripherie degradierten kommunikativen Aspekte der Sprache, das sprachliche Handeln und Sprachspiel - im wahrsten Wortsinne71 - die konstitutiv an der Kreoli- sierung des Pidgin beteiligt sind und mithin Kinder befähigen „eine komplexe Spra- che nicht nur im Hinblick auf den Wortschatz, sondern auch im Hinblick auf gramma- tische Strukturen“72 zu entwickeln. Denn auch eine in ihrer grammatischen Struktur zunächst wenig elaborierte Sprache ist notwendig komplex, faßt man sie als Ganz- heit des kommunikativen Miteinanders, als Lebensform auf und bringt als solche e- benso notwendig auch komplexe Sachverhalte oder Zusammenhänge ´zur Spra- che´.73 Erwachsene aber bleiben beim Pidgin, da ihnen die Befähigung abgeht, „ohne Lehrer komplexe Strukturen aus einem Sprach- und Verhaltensgewühl zu ext- rahieren.“74
5.3. Die solipsistische Sprachgenese am Beispiel Simons
Als Beleg dafür, „wie ein einzelnes Kind die grammatische Komplexität des von ihm aufgenommenen sprachlichen Inputs von sich aus erweitert“75, dient Pinker der Fall des gehörlosen Jungen Simon:
„Simons Eltern erlernten die Gebärdensprache erst im Alter von fünfzehn und sechzehn Jahren und beherrschten sie demzufolge nur mangelhaft. Wie in vielen Sprachen läßt sich im ASL American Sign Language, d. Verf.] eine Phrase an den Anfang des Satzes bewegen und durch ein Präfix oder Suffix als Topik des Satzes markieren. […] Der Satz Spinat, den mag ich besonders gern entspricht dieser Konstruktion annähernd. Simons Eltern benutzten sie nur selten und wende- ten sie überdies falsch an.“76
Auch die eleganteren Regeln des Verbflexionssystems des ASL wurden von den Eltern nur bedingt beherrscht:
„Sie wandten die Flexion nicht stimmig an und kombinierten nie zwei Flexionsregeln an einem Verb; ab und zu benutzten sie sie unabhängig voneinander und verknüpften sie behelfsmäßig mit einer Gebärde wie dann. In vielerlei Hinsicht verhielten sich Simons Eltern wie Pidginsprecher.“77
Obschon Simon nur zu dem häufig fehlerhaften ASL seiner Eltern Zugang hatte, war er in der Lage, die Gebärdensprache weit korrekter als sie anzuwenden und „verstand Sätze mit topikalisierten Phrasen ohne Probleme“78. Zudem benutzte er die Verbflexionen des ASL „nahezu fehlerlos“.79
Pinker folgert, daß Simon offensichtlich den „ungrammatischen >Ballast< in den Äußerungen seiner Eltern ignoriert, die von ihnen inkonsistent angewandten Flexionen herausgefiltert und sie als obligatorisch interpretiert“80 hatte. Zudem müsse er die „verborgene Logik hinter den zwei von seinen Eltern falsch benutzten Verbflexionsarten erkannt und das System des ASL […] für sich neu erfunden“81 haben. Simons sprachliche Überlegenheit gegenüber seinen Eltern ist ihm daher ein „Beispiel für Kreolisierung durch ein einzelnes Kind unserer Zeit.“82
5.3.1. Die Organisation kortikaler Informationsverarbeitung über Ähnlichkeitsrelatio- nen
Interessanterweise liefert Pinker selbst den Ansatz für eine abweichende Deutung des geschilderten Phänomens, die erneut auch ohne angeborene Grammatik aus- kommt. Indem er nämlich mutmaßt, Simon filtere den „ungrammatischen Ballast“ aus den Äußerungen der Eltern heraus und interpretiere „die von ihnen inkonsistent an- gewandten Flexionen […] als obligatorisch“. Denn die Differenz von ´ungrammatischem´ versus ´grammatischem´ Input läßt sich ebensogut als die Diffe- renz zwischen einem Input, der Regelmäßigkeiten aufweist und einem solchen, der dies nicht tut, ausdrücken. Gelernt werden kann jedoch nur aus einem regelmäßigen Input.83 Die kortikale Informationsverarbeitung basiert zudem wesentlich auf der Ähn- lichkeit eines Inputmusters mit bereits gespeicherten Repräsentationen dieses Musters. Dies geschieht
„sowohl durch ´von unten´ kommenden sensorischen bzw. niederstufig verarbeite- ten Input (Bottom-up-Prozesse) als auch durch ´von oben´ geleitete Gestaltbil- dungsprozesse aus diesem Input (Top-down-Prozesse), die von bereits gespei- chertem Input geleitet sind. Bottom-up und Top-down-Prozesse laufen zugleich durch intensive Kommunikation zwischen unterschiedlichen kortikalen Arealen ab, die sich gleichsam auf eine ´Interpretation´ eines Inputmusters ´einigen´.“84
Der Abruf eines bereits dargebotenen regelmäßigen Inputs kann dergestalt auch ü- ber die nur teilweise Darbietung dieses gespeicherten Inhalts erfolgen:
„Auch wenn der Input einem der gespeicherten Muster nur ähnlich ist, konvergiert der Aktivierungszustand des Netzwerks zu diesem Muster hin, d.h. das Netzwerk generalisiert selbsttätig über eine bestimmte Menge ähnlicher Inputmuster. Anders gewendet : Das Netzwerk leistet […] die Erkennung von Mustern auch in Fällen, in denen diese nur unvollständig oder teilweise fehlerhaft dargeboten werden.“85
Diese an Hopfield-Netzwerken festgestellten Eigenschaften sind direkt auf biologi- sche Informationsverarbeitungssysteme, also Gehirne übertragbar.86 Simon ist also durchaus in der Lage, den inkonsistent dargebotenen regelmäßigen Input zu spei- chern und diesen auch in Form einer fehlerhaften erneuten Darbietung mit Hilfe von Ähnlichkeitsrelationen zu erkennen, ganz ohne dazu eines genomisch verankerten grammatischen Nachschlagewerkes zu bedürfen. Und auch Simons spontane Ver- vollständigung des Systems der Verbflexionsendungen bedarf zu diesem Zwecke einer solchen nicht, denn:
„Abstrakte, generalisierende Repräsentationen bzw. Prototypen mit allgemeinen Eigenschaften können in neuronalen Netzwerken als Systemeigenschaft unter bestimmten Voraussetzungen spontan entstehen. Dies ist für das Verstehen der Genese jeglicher Prozesse der Gestaltbildung bis hin zu begrifflichen Repräsentationen von kaum zu unterschätzender Bedeutung. Abstrakta werden von neuronalen Netzwerken nicht als solche gelernt (d.h. z. B. im Sinne des Einprogrammierens von Regeln), sondern sie werden spontan hervorgebracht, sofern regelhafte InputOutput-Verhältnisse dem Training zugrunde liegen.“87
Die regelhafte Verwendung einfacher Varianten des Verbflexionssystems der ASL kann demzufolge durchaus bereits zu einer spontanen Generalisierung dieses Inputs durch Simon hingereicht haben, die ihn - im Gegensatz zu seinen Eltern - sodann befähigte, auch komplexere Variationen der Verbflexionen in einem grammatischen Sinne korrekt anzuwenden. Auch die „Kreolisierung durch ein einzelnes Kind“ kann mithin nicht als ein hinreichender Beweis für eine angeborene mental repräsentierte Universalgrammatik gelten.
6. Kann Sprache erlernt werden? - Chomskys Argument aus dem defizitären Input
Mit Hilfe des Chomskyschen Arguments aus dem defizitären Input sucht Pinker zu beweisen, daß Kinder grammatische Regeln beherrschen, „die ihnen nicht hätten beigebracht werden können.“88 In einem von den Psycholinguisten Stephen Crain und Mineharu Nakayama in einer Kindertagesstätte durchgeführten Versuch gelang es allen am Experiment beteiligten Kindern, den Satz
„ Das Einhorn, das gefr äß ig ist, ist im Garten. “
durch die Verschiebung des zweiten finiten Hilfsverbs „ist“ auf die erste syntaktische Position korrekt, also regelgemäß in den Fragesatz
„ Ist das Einhorn, das gefr äß ig ist, im Garten? “
umzuwandeln, anstatt eine ungrammatische Konstruktion wie etwa:
* „ Ist das Einhorn, das gefr äß ig, ist im Garten? “
zu bilden. Chomsky und Pinker zufolge liegt „des Rätsels Lösung im Bauplan der Sprache.“89 Denn obschon Sätze aus Wortketten bestehen, wählen
„Grammatikalgorithmen die Wörter nicht nach ihren linearen Positionen, wie >ers- tes Wort< oder >zweites Wort<, aus. Vielmehr ordnen Algorithmen Wörter zu Phrasen, einfache Phrasen zu komplexeren Phrasen und versehen im Geiste jede mit einem Etikett wie >Subjekt-Nominalphrase< oder >Verbalphrase<. Die eigentli- che Regel für die Bildung von Phrasen sucht nicht den Satz von links nach rechts nach dem ersten Hilfsverb ab; sie sucht nach dem Hilfsverb, das auf die Phrase mit dem Etikett >Subjekt< folgt. Diese Phrase, die die gesamte Wortkette ein Ein- horn, das gefr äß ig ist, umfaßt, verhält sich als Einheit. Das erste ist ist in diese Einheit eingebettet und bleibt für die Fragebildungsregel unsichtbar. Das zweite ist folgt dagegen unmittelbar auf die Subjekt-Nominalphrase und wird somit nach vorn gestellt.“90
Da Sätze, „aus denen die Kinder die lineare Regel als falsch und die strukturabhän- gige als richtig erkennen […] im Mutterisch91 so gut wie nie vorkommen“92, folgt für Pinker wie Chomsky der zwingende Schluß, die entsprechende Phrasenstrukturregel müsse dem Kind genetisch mit auf den Weg gegeben worden sein.
Es bedarf keiner neuen Argumente, um die Aussagekraft dieses Experiments nach- haltig in Frage zu stellen, es ist vielmehr bereits in seinen Prämissen anzuzweifeln.
Denn zwar bleibt die grammatikalische Leistung der befragten Kinder unbenommen. Es konnte jedoch bereits an anderer Stelle festgestellt werden, daß der sprachliche Input, dem Kinder im Zuge ihres Heranwachsens und Spracherwerbs ausgesetzt sind, sich weder auf das Mutterische beschränkt noch defizitär ist. Das Infans wird als sprachloses Wesen in eine sprechende Umwelt hineingeboren und ist mithin von Beginn an strukturell komplexem sprachlichem Input ausgesetzt. Die Leistung des Kindes besteht darin, aus von vornherein keineswegs lerngerecht portionierten sprachlichen Äußerungen strukturelle Regelmäßigkeiten abzuleiten und also am Bei- spiel zu lernen. Dies Vermögen ist - wie in Kapitel 5. 2. 1. beschrieben - notwendig an die noch unvollendete Myelinisierung der kortikalen Nervenfaserverbindungen gebunden. Weder Chomsky noch Pinker sind in der Lage zu gewährleisten, daß kei- nes der beteiligten Kinder in seiner sprechenden Umgebung je Fragesätzen - ganz gleich welcher syntaktischen Struktur - begegnet wäre. Zudem muß die Umwand- lung eines Aussagesatzes in einen Fragesatz als Teil des sprachlichen Alltags be- trachtet werden. Abstrahiert man jedoch von der etwas naiv anmutenden Prämisse, der sprachliche Input sei defizitär, so wird das Experiment ganz notwendig seiner Beweiskraft beraubt. Denn die strukturelle Regelmäßigkeit der Umstellung des Sat- zes kann im tagtäglichen sprachlichen Miteinander erlernt worden sein.
7. Die neuronale Lokalisation der Sprachfähigkeit
Um die Beweisführung, „daß Sprache ein spezifischer Insitinkt ist“, zu einem erfolg- reichen Abschluß zu bringen, fehlt - so Pinker - nur noch ein Glied in der Indizienket- te: „Ist Sprache wirklich ein Instinkt, so muß sie an einer identifizierbaren Stelle im Gehirn verankert und möglicherweise sogar von einer Truppe ganz spezieller Gene dort installiert worden sein.“93 Gleichwohl muß er einräumen, daß „bisher noch nie- mand ein Sprachorgan oder Grammatikgen entdeckt“94 habe. Da ein biologischer Nachweis also nicht geleistet werden kann, sucht Pinker die notwendige Evidenz in- direkt zu erbringen: Würden nämlich die besagten Grammatik- Gene oder Neuronen beschädigt,
„so müßte dies das Sprachvermögen in Mitleidenschaft ziehen, während andere kognitive Funktionen aufrechterhalten würden. Blieben sie in einem ansonsten ge- schädigten Gehirn unversehrt, so führte dies zu einem retardierten Individuum mit intakter Sprache, einem linguistischen idiot savant.“95
Den ersten Fall findet Pinker im Krankheitsbild der Broca - Aphasie bestätigt, die durch Verletzungen bestimmter Nervenbahnen im unteren Teil des vorderen Lap- pens der linken Gehirnhälfte gekennzeichnet ist. Patienten, die an einer solchen A- phasie leiden, sind im Vollbesitz ihrer kognitiven Fähigkeiten, mit Ausnahme der Sprache. ntellektuelle Fähigkeiten, die nicht mit Sprache verbunden sind, etwa die Unterscheidung von rechts und links oder die Fähigkeit zu rechnen, Karten zu lesen und Uhren zu stellen, funktionieren einwandfrei. Die Grammatik hingegen ist gestört: So werden etwa Wortendungen und grammatische Funktionswörter (or, be) beim Lesen weggelassen. Gleichwohl können gleichlautende Inhaltswörter (bee, oar) ge- lesen werden.
Gleichsam entgegengesetzte Symptome weisen Patienten auf, die am sogenannten Williams-Beuren-Syndrom leiden. Ein defektes Gen auf Chromosom 11 hat in diesem Krankheitsbild komplexe Auswirkungen auf die Entwicklung des Gehirns. Die Patienten haben einen IQ von etwa 50 und versagen bei alltäglichen Aufgaben, wie etwa dem Binden von Schuhen oder dem Zusammenzählen von zwei Zahlen. Gleichwohl sind sie grammatisch hochkompetent. Sie können komplexe Sätze verstehen und bilden und ungrammatische Sätze korrigieren.96
Zwar können im Rahmen der vorliegenden Arbeit weder das Krankheitsbild der Broca-Aphasie noch das des Williams-Beuren-Syndroms sachgerecht behandelt werden, gleichwohl können den Pinkerschen Thesen über die neuronale Lokalisation der Sprache Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften gegenübergestellt werden, die seine Annahmen relativieren:
Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, enthalten neuronale Netzwerke keine Regeln. Ihre Tätigkeit läßt sich zwar ex post durch Regeln beschreiben, aber „ Regeln sind nicht im Kopf, sie sind lediglich brauchbar, um bestimmte Leistungen im nachhinein zu beschreiben.“97 „Wurde früher von Linguisten wie Chomsky und seiner Schule angenommen, daß sprachliche Regeln irgendwie im Gehirn als Regeln repräsentiert sein müßten, so ist diese Annahme […] widerlegt.“98 Richtig ist allerdings, daß die vom Gehirn zu bewältigenden Aufgaben der Informationsverarbeitung in Module zer- legt und an spezifischen Stellen des Gehirns verarbeitet werden, das Gehirn mithin modular organsisiert ist. Aber „Modularität meint […] gerade nicht die Unverbundenheit von Teilsystemen“ - wie von Pinker gemutmaßt - sondern im Gegenteil „die Zusammenarbeit bzw. die Vernetzung von Karten.“99 Die Produktion und das Verständnis von Sprache sind zudem als „[k]omplexe Leistungen“100 aufzufassen, die nur in enger Zusammenarbeit mehrerer Hirnareale vollzogen werden können. „Die gesitigen Funktionen resultieren aus der Operation jeder der separaten Komponenten und aus der konzertierten Aktion der vielfältigen Systeme, die sich aus diesen separaten Komponenten zusammensetzen.“101 So gehen die Neurologen Hanna und Antonio Damasio davon aus, daß das „Gehirn die Sprache mittels dreier wechselwirkender Gruppen von Strukturen verarbeitet.“102
„Die erste, eine ganze Batterie neuraler Systeme sowohl in der rechten als auch in der linken Hemisphäre, ist für den nichtsprachlichen […] Austausch zwischen dem Organismus und seiner Umgebung vorhanden - das heißt für all das, was eine Person tut, wahrnimmt, denkt oder fühlt. […] Die zweite Gruppe - eine kleinere Anzahl neuronaler Systeme, die zumeist in der linken Hirnhälfte lokalisiert sind - repräsentiert Phoneme, Phonem - Kombinationen und syntaktische Regeln für das Kombinieren von Wörtern […]. […] Eine dritte Gruppe von Strukturen […] vermittelt zwischen den ersten beiden. “103
Natürlich ist eine Repräsentation syntaktischer Regeln nicht im Sinne einer ´Regel im Kopf´ aufzufassen. „Vielmehr legt das Gehirn gewissermaßen ein Protokoll der Nerventätigkeit an“, es „verzeichnet quasi Muster synaptischer Verbindungen“104, die einen bestimmten Vorgang der Informationsverarbeitung charakterisieren. Unterschiedliche Wortarten und Begriffe sind zudem an ganz unterschiedlichen Stel- len des Gehirns repräsentiert, denn das „Gehirn benutzt notwendigerweise unter- schiedliche neuronale Systeme, um Gegenstände zu repräsentieren, die sich in Struktur oder Verhalten unterscheiden, oder für Objekte, die zur betreffenden Person in unterschiedlicher Beziehung stehen.“105 Und die verschiedenen neuralen Struktu- ren, „welche die Begriffe selbst repräsentieren, verteilen sich über viele sensorische und motorische Regionen in beiden Hemisphären des Gehirns.“106 Mithin kann nicht im Sinne Pinkers von Sprache als einer modular isolierten Verarbeitungsstruktur ausgegangen werden.
Zusammenfassung der Ergebnisse
Die Gegenüberstellung der von Pinker vorgetragenen Thesen und Beispiele und der im Rahmen von Untersuchungen an neuronalen Netzwerken gewonnenen alternati- ven Deutungsansätze hat gezeigt, daß den von Pinker ausgewählten Belegen keine induktive Beweiskraft zukommt. Denn weder die Umwandlung von Pidgin in Kreol- sprachen durch mehrere Kinder noch die Kreolisierung der Gebärdensprache durch Simon lassen den eindeutigen Schluß auf die Existenz oder Notwendigkeit eines mentalen Grammatik - Organs im Sinne Pinkers und Chomskys zu. Auch das gegen die Erlernbarkeit von Sprache bzw. Grammatik vorgebrachte Argument aus dem de- fizitären Input muß schon in seinen Prämissen angezweifelt werden und scheint mit- hin wenig aussagekräftig. Der These, Sprache sei als eine eng umgrenzte Fähigkeit, ein in seinem Wirken isoliertes mentales Modul zu beschreiben, muß gänzlich wider- sprochen werden. Die Erkenntnisse der Neurowissenschaften belegen gerade das Gegenteil und legen mithin nahe, die menschliche Sprache und Sprachfähigkeit als ein komplexes Vermögen anzusehen.
Bibliographie
Becker, Barbara 1998: Leiblichkeit und Kognition. Anmerkungen zum Programm der Kognitionswissenschaften.- In: Gold, P. et al. (Hg.): Der Mensch in der Perspektive der Kognitionswissenschaften.- Frankfurt/Main: 1998.
Burkhardt, Angelika.1988: Steven Pinker. Der Sprachinstinkt. Wie der Geist die Sprache bildet.- In:Muttersprache.Vierteljahresschrift für deutsche Sprache.108,1(1998), 81-86.
Chomsky, Noam 1977: Reflexionen über die Sprache.- Frankfurt/Main: 1977.
Ders. 1981: Regeln und Repräsentationen.- Frankfurt/Main: 1981.
Ders.1996: Probleme sprachlichen Wissens.- Weinheim: 1996.
Damasio, Antonio R. 1999: Descartes´ Irrtum. Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn.- 4. Aufl., München: 1999.
Ders. 1997: Brain and language: what a difference a decade makes.- In: Current Opinion in Neurology. 10, 3 (1997) 173f.
Damasio, Hanna u. Antonio R. 1993: Sprache und Gehirn.- In: O. A.: Signale und Kommunikation. Mechanismen des Informationsaustauschs in lebenden Systemen.- Heidelberg (u.a.): 1993
Engel, A. K./ König, P. 1998: Das neurobiologische Wahrnehmungsparadigma. Eine kritische Bestandsaufnahme.- In: Gold, P. et. al. (Hg.): Der Mensch in der Perspektive der Kognitionswissenschaften.- Frankfurt/Main: 1998, 156-195.
Jäger, Ludwig 1991: Sprachliche Soziogenese und linguistischer Biologismus.- In: Dietrich Busse (Hg.): Diachrone Semantik und Pragmatik. Untersuchung zur Erklärung und Beschreibung des Sprachwandels.- Tübingen: 1991, 139-196.
Ders. 1993b: Sprache oder Kommunikation. Zur neuerlichen Debatte über das Erkenntnisobjekt der Sprachwissenschaft.- In: Heringer, Hans Jürgen (et al.) (Hg.): Sprachgeschichte und Sprachkritik: Festschrift für Peter von Polenz zum 65. Geburtstag.- Berlin (u.a.): 1993.
Ders. 1993f: „Language, what ever that may be.“ Die Geschichte der Sprachwissenschaft als Erosionsgeschichte ihres Gegenstandes.- In: Zeitschrift für Sprachwissenschaft (ZS), 12,1 (1993), 77-106.
Ders. 1993g: „Chomskys Problem“. Eine Antwort auf Bierwisch, Grewendorf und Habel.- In: Zeitschrift für Sprachwissenschaft (ZS), 12,2(1993), 235-260.
Ders.1999: Sprache als Medium. Über die Sprache als audio-visuelles Dispositiv des Medialen.- (Manuskript) Aachen/Köln: 1999 [erscheint].
Monod, J. 1975: Zufall und Notwendigkeit. Philosophische Fragen der modernen Biologie.- München: 1975.
Oeser, E., Seitelberger, F. 1988: Gehirn, Bewußtsein und Erkenntnis.- Darmstadt: 1988.
Osche, G. 1987: Die Sonderstellung des Menschen in biologischer Sicht: Biologische und kulturelle Evolution.- In: Siewing, E. (Hg.): Evolution. BedingungenResultate-Konsequenzen.- Stuttgart (u.a.): 1987.
Pinker, Steven 1996: Der Sprachinstinkt. Wie der Geist die Sprache bildet.- München: 1996.
Putnam, Hilary 1991: Repräsentation und Realität.- Frankfurt/Main: 1991.-
Prinz, Wolfgang 1996: Bewußtsein und Ich-Konstitution.- In: Gerhard Roth (et. al.) (Hg.): Kopf - Arbeit: Gehirnfunktionen und kognitive Leistungen.- Heidelberg (u.a.): 1996, 451- 467.
Searle, J. R. 1971: The Philosophy of Language.- Oxford: 1971.
Spitzer, Manfred 2000: Geist im Netz. Modelle für Lernen, Denken und Handeln.Heidelberg (u.a.): 2000.
Stetter, Christian 1996: Strukturale Sprachwissenschaft (20. Jahrhundert).- In: Borsche, Tilman: Klassiker der Sprachphilosophie.- München: 1996, 421-516.
Ders. 1999: Schrift und Sprache.- Frankfurt/Main: 1999.
Ders. 1999: Am Ende des Chomsky-Paradigmas - zurück zu Saussure?.- (Ms.) Aachen: 1999 [erscheint.]
Wittgenstein, Ludwig 1995: Werkausgabe Bd. 1. Tractatus logico-philosophicus [u.a.].- 10. neu durchges. Aufl. Frankfurt/Main: 1995.
[...]
1 Steven Pinker: Der Sprachinstinkt. Wie der Geist die Sprache bildet.- München: 1996, 21.
2 Ebd.
3 Ebd.
4 Darwin, 1874 (1992) zitiert nach: Pinker 1996, o.c., 23
5 Vgl. Noam Chomsky: Regeln und Repräsentationen.- Frankfurt/M: 1981, 17.
6 Ebd, 223.
7 vgl. ebd.
8 Genaugenommen wird auch die Grammatik noch getrennt, die einzelsprachliche Grammatik von der Universalgrammatik nämlich. Im Folgenden soll jedoch der Kürze halber von Grammatik stets im Sinne der Universalgrammatik die Rede sein.
9 Chomsky 1980, 3, zitiert nach: Ludwig Jäger: Sprache oder Kommunikation?[…].- In: Sprachge- schichte und Sprachkritik.[…].- Berlin:1993, 11-33, 23. [Im Folgenden: `Jäger 1993b´].
10 Chomsky 1981 o.c.,88.
11 Vgl. ebd., 95.
12 Ebd., 88.
13 Ebd., 231.
14 Pinker 1996, o.c., 22.
15 Pinker 1996, o.c., 25.
16 ebd. 25f.
17 Noam Chomsky: Reflexionen über die Sprache.- Frankfurt/M: 1977.
18 Eine umfassende Diskussion des Chomsky-Paradigmas und vor allem der Thesen seiner Gegner muß freilich im Rahmen dieser Arbeit unterbleiben. Gleichwohl sollen im folgenden Kapitel ausge- wählte Thesen einiger Protagonisten dieses mit Vehemenz geführten Diskurses beleuchtet werden.
19 Chomsky 1990, 632. Zitiert nach Ludwig Jäger: Language, what ever that may be.- In: ZS 12,1 (1993), 77 - 106, 78 [im Folgenden: ´Jäger 1993f´].
20 vgl. Jäger 1993b, o. c., 22.
21 Ebd, 22.
22 Vgl. ebd., 79.
23 Jäger 1993b, o. c., 13.
24 Jäger 1993f, o. c., 79.
25 Ebd.
26 Vgl ebd.
27 Christian Stetter: Schrift und Sprache.- Frankfurt/M: 1999, 156 [im Folgenden: ´Stetter 1999´].
28 Zu einer detaillierten Auseinandersetzung mit dem Arbitraritätsprinzip vgl. Stetter 1999, o. c.,143 -
172.
29 Christian Stetter: Strukturale Sprachwissenschaft.[…].- In:Tilman Borsche (Hg.): Klassiker der
Sprachphilosophie.[…].- München: 1996, 421-516, 442 [im Folgenden: ´Stetter 1996´].
30 ebd.
31 Vgl. Jäger 1993g, o. c., 257.
32 ebd., 248.
33 Stetter 1996, o. c., 439.
34 Dieser Nachweis ist den rezenten Erkenntnissen der Neurowissenschaften zufolge derzeit nicht absehbar.
35 Stetter 1996, o. c., 440.
36 Pinker 1996, o. c., 31.
37 vgl. Kap. 1
38 vgl. Pinker 1996, o. c., 31.
39 Ebd.
40 vgl. ebd. 32-36.
41 Ebd., 28.
42 Ludwig Jäger: Sprachliche Soziogenese und linguistischer Biologismus.- In: Dietrich Busse (Hg.): Diachrone Semantik und Pragmatik.[…].- Tübingen: 1991, 139-196,171 [im Folgenden: ´Jäger 1991´].
43 Chomsky 1981, o. c., 216.
44 seien diese nun gestisch/visueller oder vokal/auditiver Natur
45 Osche beschreibt den der Sprache immanenten evolutionären Vorteil wie folgt: „Das entscheidende Neue ist, daß die Wortsprache des Menschen Symbole benutzt und die Weitergabe von Information damit vom Objekt befreit. […] Durch Verwendung von Wortsymbolen kann man über Dinge spre- chen, ohne daß diese zugegen sind. Man kann Vergangenes vergegenwärtigen und auch über Zu- künftiges sprechen, also nach-denken und die Zukunft mit Voraussicht planen.“ Osche 1987, 503. Zitiert nach: Jäger 1991,181. Damasio stellt fest: „Sprache ist vielleicht nicht der Ursprung des Selbst, aber ganz gewiß der des >Ich<.“ Antonio Damasio: Descartes´ Irrtum.- München: 1999, 323. Zum Zusammenhang von sprachlicher Phylogenese und Ich-Konstitution vgl. auch Wolfgang Prinz: Bewußtsein und Ich-Konstitution.- In: Gerhard Roth (et al.): Kopf-Arbeit.[…].- Heidelberg: 1996.
46 Oeser/Seitelberger 1988, 98, zitiert nach Ludwig Jäger: Sprache als Medium.[…].- 1999 (Ms.),14 [erscheint].
47 Monod 1975, 119, zitiert nach Jäger 1999 (Ms.), o. c.,13.
48 Die Kategorie der ´komplexen´ natürlichen Sprache ist aber nur dann sinnvoll, wenn sie der Ab- grenzung von einer Kategorie der ´nicht-komplexen´ natürlichen Sprache dient. Andernfalls bleibt die Universalität natürlicher Sprachen in menschlichen Gesellschaften zu konstatieren. Zwar gibt es Behelfssprachen (vgl. Kap 2), aber auch im Falle etwa des Pidgin gilt die Wittgensteinsche Rede von Sprache als Lebensform (vgl. Ludwig Wittgenstein: Werkausgabe Bd.1 […].-Frankfurt/M.: 1995, 356) der als solcher ganz notwendig Komplexität zukommt. Von einer nicht-komplexen Sprache wä- re also auch in diesem Fall nur unter den Vorzeichen des Chomsky-Paradigmas zu sprechen, wenn nämlich mit Sprache Grammatik gemeint ist.
49 Vgl Putnam, H.: The ´Innateness Hypothesis´ and Explanatory Models in Linguistics.- In: Searle, J.R.: The Philosophy of Language.- Oxford: 1971, 135.
50 Ebd., 37.
51 Ebd., 41.
52 Ebd., 43f.
53 Ebd., 53.
54 Ebd., 38.
55 Vgl. ebd., 40.
56 Ebd., 38.
57 Vgl. ebd., 41.
58 Ebd., 41.
59 Ebd., 38.
60 Die folgenden Ausführungen sind Manfred Spitzer: Der Geist im Netz.[…].- Heidelberg: 2000, 189 - 203. entnommen. Eine umfassende Darstellung der Theorie neuronaler Netzwerke kann aus Platz- gründen im Rahmen dieser Arbeit leider nicht vorgenommen werden. Zu einer Einführung sei auf Spitzer 2000 verwiesen. Zum Verhältnis von Kognitivismus und Konnektionismus vgl. auch: A. K.
61 Spitzer 2000, o. c., 191.
62 Ebd. 197.
63 Ebd. 198.
64 Ebd. 199.
65 Ebd.
66 Zum Begriff der ´Myelinisierung´ expliziert Spitzer:„Zwar sind bei der Geburt bereits die Nervenzel- len vorhanden, die verbindenden Faserzüge sind jedoch in vielen Arealen noch nicht mit einer Iso- lationsschicht aus Myelin versehen.[…] Sind die Fasern noch nicht myelinisiert, kann praktisch kei- ne rasche Informationsverarbeitung stattfinden. De facto ist eine nicht myelinisierte Nervenfaser- verbindung im Kortex so etwas wie eine tote Telefonleitung“. Spitzer 2000, o.c., 195.
67 Ebd.,200.
68 Ebd., 211.
69 Ebd., 200.
70 Ebd. 200f.
71 Denn „Spiel ist […]die unmittelbare Konsequenz von Lernfähigkeit.“ Spitzer 2000, o.c.,62.
72 Ebd., 201.
73 Zur Vernachlässigung der körperlichen Seite des Sprachbegriffs innerhalb des Chomsky- Paradigmas vgl. auch B. Becker: Leiblichkeit und Kognition[…].- In P. Gold 1998.
74 Ebd.
75 Pinker 1996, o.c., 44.
76 Ebd. 44.
77 Ebd. 45.
78 Ebd.
79 Ebd.
80 Ebd.
81 Ebd., 45f.
82 Ebd., 46.
83 Vgl. Spitzer 2000, o. c. ,111.
84 Ebd. 147.
85 Ebd. 185.
86 Vgl. ebd.
87 Spitzer 2000 o. c. 132.
88 Pinker 1996, o. c. 47.
89 Ebd., 48.
90 Pinker 1996, o. c., 48.
91 Unter dem Mutterischen wird der Kindern von ihren Müttern indirekt erteilte Sprachunterricht ver- standen. Er umfaßt „Intensivkurse in Konversation mit Wiederholungsübungen und einer verein- fachten Grammatik. (>Guck der Wauwau! Wo ist der Wauwau? Da ist der Wauwau!<)“ Ebd., 46.
92 Ebd., 49.
93 Pinker 1996, o. c., 53.
94 Ebd.
95 Ebd.
96 Vgl. Pinker 1996, o. c., 55-63.
97 Spitzer 2000, o. c., 29.
98 Ebd., 33.
99 Ebd., 122.
100 Ebd., 121f.
101 Damasio 1999, o. c., 40.
102 Hanna u. Antonio R. Damasio: Sprache und Gehirn.- In: O.A.: Signale und Kommunikation.[…].- Heidelberg: 1993, 140.
103 Ebd., 140f.
104 Ebd., 142.
105 Ebd., 146.
106 Ebd.,145.
- Arbeit zitieren
- Jan Hoppe (Autor:in), 1999, Ist Sprache ein Instinkt? Eine kritische Diskussion des Pinkerschen Plädoyers für die Instinkthaftigkeit von Sprache am Beispiel seiner Thesen zum kindlichen Erstspracherwerb., München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101896
Kostenlos Autor werden













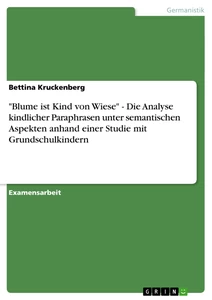






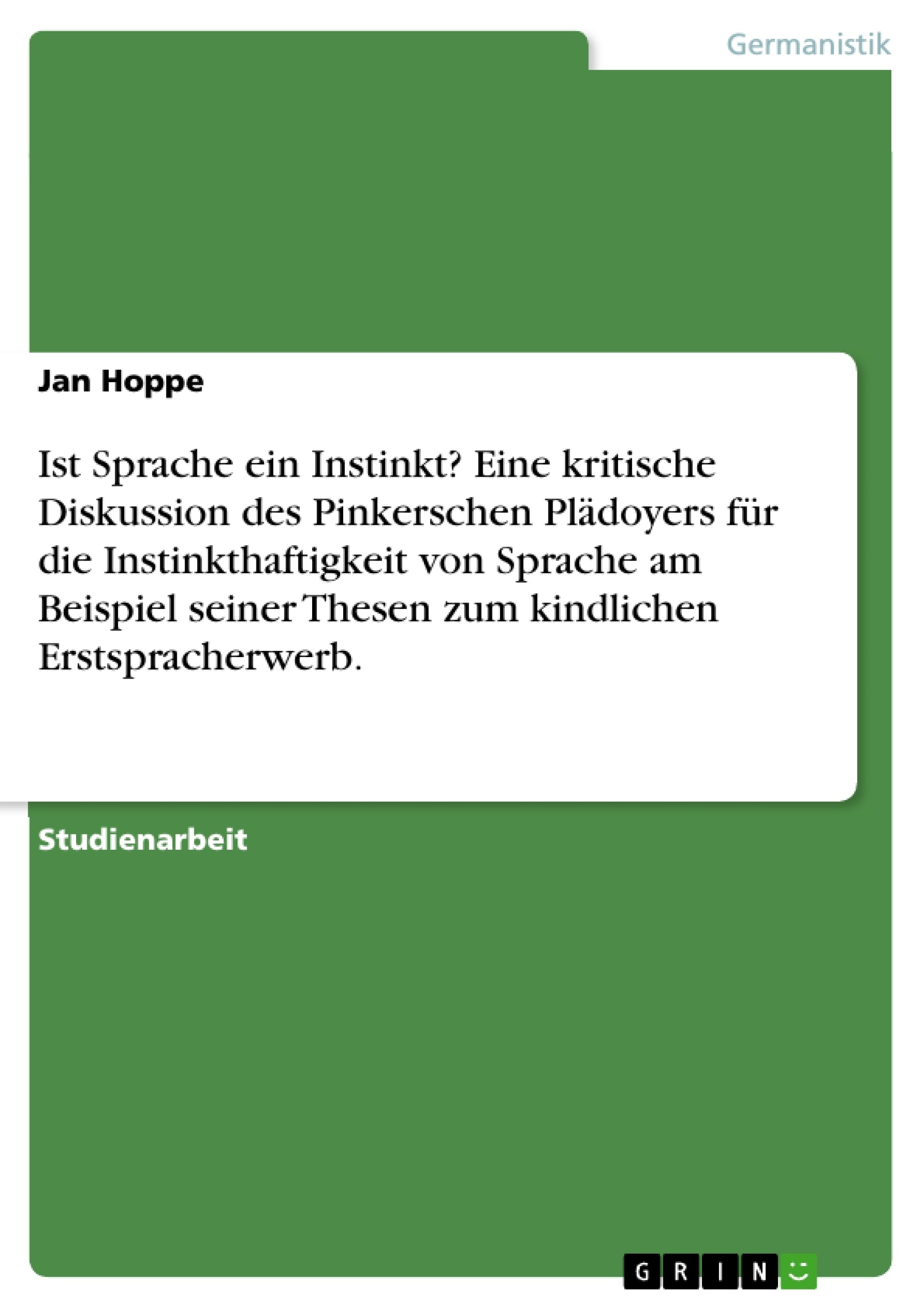

Kommentare