Leseprobe
Inhaltsübersicht
1. Einleitung
2. Zur sozialen Struktur an französischen Universitäten
2.1. Repräsentation der Klassen
2.2. Fächerwahl
2.3. Wahl der Universität
2.4. Länge der Studienzeit
2.5. Geschlecht als Faktor
3. Differenzierungsfaktoren
3.1. Soziale Herkunft
3.2. Einstellung zum Studium
3.3. Kulturelle Kenntnisse
3.4. Unterrichtsinhalt
3.5. Aufstiegsbereitschaft
4. Fazit
5. Anhang
Die Illusion der Chancengleichheit
1. Einleitung
In dem vorliegenden Abschnitt "Auslese und Gnadenwahl: Soziale Struktur und Studienerfolg der Studenten" aus dem Buch "Die Illusion der Chancengleichheit" von Pierre Bourdieu und Jean-Claude Passeron aus dem Jahre 1971 nehmen die Autoren eine Analyse der sozialen Struktur französischer Universitäten zu Beginn der 70er Jahre vor. Hierbei kommen die Autoren zum Schluss, dass es eine Ungleichheit der Bildungschancen für die einzelnen Gesellschaftsklassen gibt, was sie insbesondere aus der Missrepräsentation der sozialen Klassen an den Universitäten herleiten. Desweiteren nehmen die Autoren eine Analyse der Differenzierungsfaktoren vor, die diese Ungleichheit der Bildungschancen bedingen.
2. Zur sozialen Struktur an französischen Universitäten
2.1. Repräsentation der Klassen
Aus Tabelle 1 geht hervor, wie groß die Wahrscheinlichkeit, und damit verbunden die objekte Chance eines Hochschulbesuches für Kinder mit entsprechender familiärer Herkunft Anfang der 70er Jahre in Frankreich ist. Hierbei zeigt sich deutlich, dass insbesondere für Kinder aus unterprivilegierten Klassen (Arbeiter, Bauern, Dienstleistungspersonal) die Chance eines Hochschulbesuch mit Werten zwischen 0,7 % und 3,6 % verschwindend gering ist und somit für Kinder jener Gesellschaftsschicht nur eine symbolische Chance auf einen Hochschulbesuch besteht. Für Kinder aus Angestellten und Selbstständigenfamilien schwanken die Werte zwischen 9,5 und 16,4 %, während sie sich für Kinder aus der mittleren Schicht auf 29,6 % verdoppeln. Für Kinder aus Freiberuf- lerfamilien und Führungskadern liegen die Chancen mit 58,5 % nochmals doppelt so hoch. Es besteht also ein krasses Missverhältnis, was die Studienchancen für Kinder aus den einzelnen Klassen angeht. Ein Studium ist für ein Arbeiterkind alles andere als eine Selbstverständlichkeit, während es umso wahrscheinlicher wird, je höher man in der sozialen Struktur familiär verwurzelt ist.
Dieses Missverhältnis tritt noch umso deutlicher zutage, wenn man die Anzahl der Studierenden aus der jeweiligen Klasse mit der Repräsentation ihrer Klasse in der arbeitenden Bevölkerung vergleicht (vgl. Graphik 2). Hierbei zeigt sich, dass die an der Universität am stärksten vertretene Klasse der Freiberufler und Führungskader in der arbeitenden Bevölkerung am schwächsten vertreten ist.
Die Autoren sehen diese Zahlen als das Ergebnis eines Ausleseprozesses, der bereits schon in der Schule beginnt und der im Falle der unterprivilegierten Klassen zu der fast totalen Eliminierung ihrer Studienchancen am Ende der Schulzeit führt.
2.2. Fächerwahl
Auch bei der Fächerwahl tritt ein Gefälle bezüglich der sozialen Herkunft hervor. Hier wird deutlich, dass die unteren Klassen in ihrer Wahl stärker eingeschränkt sind (vgl. Graphik 2). Generell ist eine Abdrängung der minderprivilegierten Klassen auf ein Studium an der philosophischen oder naturwissenschaftlichen Fakultät festzustellen. So liegt z.B. die Chance auf ein Jura-. Medizin- oder Pharmakologiestudium für Landarbeiterkinder bei 15,3 % und für Arbeiterkinder bei 17,3 %, während sie für Kinder mittlerer Kader auf 23,9 % und für Kinder aus Führungskadern sogar auf 33,5 % ansteigt.
2.3. Wahl der Universität
Sind die Zugangschancen auf die verschiedenen Disziplinen bereits schon durch die soziale Herkunft determiniert, so gilt dies insbesondere für die Verteilung der Studierenden auf die einzelnen Universitäten. Wie aus Tabelle 2 hervorgeht, nimmt der Anteil Studierender privilegierter Herkunft mit steigendem Prestige der jeweiligen Universität zu. Besonders deutlich wird dies an der Ecole Normale Sup,rieure und der Ecole Polytechnique, die zu 57 %, bzw. 51 % von Söhnen und Töchtern aus Führungskadern und Freiberuflerfamilien besucht werden, sowie zu 15 %, bzw 26 % von Kindern mittlerer Kader.
2.4. Länge der Studienzeit
Desweiteren ist festzustellen, dass Studierende aus den unterprivilegierten Schichten in der Regel länger für ihren Abschluss brauchen. Der Prozentsatz von Studierenden im modalen Alter - also dem für die jeweiligen Stufe häufigsten Alter - ist besonders bei Studierenden der unteren Klassen gering, dagegen bei den ältesten Jahrgängen, den sogenannten "Langzeitstudenten", am höchsten (vgl. Tabelle 2.11.).
2.5. Geschlecht als Faktor
Bezüglich des Geschlechtes sind die Bildungschancen für Mädchen und Jungen in bezug auf ihre Klasse entweder entsprechend gleich gut oder gleich schlecht (vgl. Tabelle 1). Es lässt sich über alle Klassen hinweg jedoch eine leichte Benachteiligung der Mädchen feststellen - die Chancen für ein Studium liegt für Mädchen bei 8 %, für Jungen bei 10 % - die sich in den unteren Klassen umso bemerkbarer macht.
Desweiteren schlagen sich in der Fächerwahl die traditionellen Modelle der Arbeits- und Begabungsteilung zwischen den Geschlechtern nieder. So entscheiden sich zwischen 40 bis 50 % der Jungen aller gesellschaftlichen Klassen für einen Studiengang in den Naturwissenschaften, während sich die Mehrheit der Mädchen für einen Studiengang in den Geisteswissenschaften entscheidet, wobei die Werte hier sogar zwischen 44 und 65,6 % liegen (vgl. Graphik 2). Zwar entscheiden sich immerhin ein Drittel der Mädchen klassenübergreifend für ein Studium der Naturwissenschaften, jedoch ist dies in der Regel mit dem Ziel verbunden, später einen Lehrberuf in diesem Fach zu ergreifen. Generell kann man hier also von einer Abdrängung der Studentinnen in Lehrberufe und Studiengänge der Philosophischen Fakultät sprechen.
Hinzu kommt, dass sich die bereits obig festgestellte Einschränkung der Studienfächerwahl für Studierende geringer sozialer Herkunft umso stärker bei den Studentinnen auswirkt. So sind 92,2 % aller Landarbeitertöchter in einem Studiengang der philosophischen oder der naturwissenschaftlichen Fakultät eingeschrieben gegenüber 80,9 % der Jungen aus der gleichen Gruppe. Bei Töchtern von Führungskadern sinkt dieser Wert zwar immerhin auf 74,3 %, liegt aber gegenüber den 58,3 % bei den Jungen immer noch vergleichsweise hoch.
3. Differenzierungsfaktoren
Im folgenden nehmen die Autoren eine Analyse der kulturellen Faktoren vor, die die Ungleichheit der Bildungschancen bewirken. Konkret untersucht wurde dies anhand der philosophischen Fakultät, da sich hier nach Auffassung der Autoren die unterschiedlichen Einflüsse der Herkunft auf die Studierendenschaft am deutlichsten bemerkbar machen.
3.1. Soziale Herkunft
Die soziale Herkunft macht den Autoren zufolge den stärksten Differenzierungsfaktor aus, denn er nimmt Einfluss auf sämtliche Gebiete und Stufen des studentischen Erfahrungsbereiches, vor allem aber auf die Existenzbedingungen. Zu diesen zählen die Autoren vor allem die folgenden:
-Wohnverhältnisse:50 bis 60 % der Studierenden aus der Oberklasse (vor allem Studentinnen) wohnen noch bei ihren Eltern. Bei Arbeitern- und Bauernkinder sind dies zwischen 10 bis 20 %.
-Lebensführungsstil
-verfügbare finanzielle Mittel, und damit verbunden
-Stärke des Abhängigkeitsgefühls
-Erwerbsgebundene Wertvorstellungen
Gerade bezüglich der finanziellen Mittel kann nicht von einer einheitlichen Studierendensituation gesprochen werden. Gerade mal 14 % der Kinder aus den unterprivilegierten Klassen werden von der Familie getragen, 36 % von ihnen sind auf eine Nebentätigkeit angewiesen. Kinder aus den Führungskadern und Freiberuflerfamilien werden zu 57 % von zuhause unterstützt und nur 11 % von ihnen muss zusätzlich arbeiten gehen (vgl. Tabelle 3).
Auch in der Benutzung des Bildungswesens wirkt sich die soziale Herkunft als entscheidendster Faktor auf den gesamten Bildungsgang und seine Wendepunkte aus. Sie determiniert auch das Gefühl, nach denen sich der betreffende Studierende in seinem oft von einem bestimmtem Milieu geprägten Studiengang "am richtigen Platz" oder "fehl am Platze" empfindet. Die Autoren nennen hier vor allem folgende Faktoren:
- notwendigefinanzielle Voraussetzungenfür Studium und Beruf
- verfügbareVorinformationenüber Studien- und Berufsmöglichkeiten
-soziales Milieudes jeweiligen Berufes und Studienfaches
-Anpassungsfähigkeitan die im Bildungswesen vorherrschenden Vorbilder, Regeln,
Wertvorstellungen
Insbesondere bei Fächern, die ein bestimmtes intellektuelles Vorwissen, kulturelle Gewohnheiten oder finanzielle Grundmittel voraussetzen, bewirken obige Faktoren trotz prinzipiell gleicher Befähigung eine ungleiche Erfolgsquote je nach Gesellschaftsklasse.
3.2. Einstellung zum Studium
Auch in der Einstellung zum Studium zeigen sich signifikante Unterschiede zwischen Studierenden der unterprivilegierten und der bürgerlichen Klasse. Studierende bürgerlicher Herkunft vertreten entschiedener die Begabungsideologie und sind zudem auch weitaus überzeugter von ihrem eigenen Talent als Kinder der unterer Klassen es sind, wenngleich sich dies im Vergleich der Studienleistungen nicht bestätigt. Zudem weisen Studierende bürgerlicher Herkunft einen stärkeren Dilettantismus in ihrem Studienverhalten auf, ihr intellektuelles Engagement scheint von eher willkürlichem Charakter: Sie lehnen die klassischen universitären Arbeitsmethoden tendenziell ab und zeigen eine Präferenz für exotische Themen und Fächerkombinationen (vgl. Tabelle 3). Zusätzlich zeigen sie eine größere Distanziertheit zu ihrem Studienfach, die paradoxerweise von der Universität als positiv angesehen und entsprechend honoriert wird, da diese Distanziertheit die wissenschaftlichen Objektivität fördert.
3.3. Kulturelle Kenntnisse
Bezüglich der kulturellen Kenntnisse wird ebenfalls deutlich (s. Tabelle 4), dass Kinder höherer Klassen hier einen Vorsprung genießen. Insbesondere was die Vertrautheit mit Kunstwerken durch Theater-, Museums- oder Konzertbesuche angeht, auch im Hinblick auf modernere und weniger "schulmäßige" Werke, sind sie gegenüber den minderprivilegierten Klassen im Vorteil. Allgemein gilt, dass jene sogenannten "freien Interessen", die in bestimmten Fächern sogar implizite Bedingung für den Studienerfolg darstellen, um so vielfältiger und umfassender vorhanden sind, desto höher die soziale Herkunft des jeweiligen Kindes ist (vgl. Tabelle 4). Hier schlagen sich unmittelbar die kulturellen Klassengewohnheiten und wirtschaftlichen Faktoren nieder, so dass gerade auf dem Gebiet der kulturellen Erfahrungen die Ungleichheit der Bildungschancen mangels eines entsprechend organisierten Unterrichts besonderen stark hervortritt.
Auch in jenen kulturellen Bereichen, die durch die Schule vermittelt werden und wo die Kinder aus oberen und unteren Klassen gleichwertige kulturelle Kenntnisse besitzen (wie z.B. beim klassischen Theater), sind sie jedoch immer durch die Art ihrer kulturellen Erfahrung voneinander getrennt. Für Kinder aus den unteren Klassen bleibt die Schule in dieser Hinsicht der einzige Wissensvermittler, wobei jenes Wissen in Bezug auf den kulturellen Rahmen nur eine Bildung geringeren Wertes darstellt, während für Kinder aus den privilegierten Klassen die durch das Familienmilieu erworbene Einstellung zur Kultur ebenso prägend ist wie die kulturelle Bildung durch die Schule.
Ob jedoch aus dieser standesgemäßen Immersion privilegierter Kinder in die hohe Kultur auch der entsprechende Nutzen gezogen werden kann, hängt jedoch auch unmittelbar mit der Einstellung des jeweiligen Kindes zu diesen kulturellen Gegebenheiten zusammen. Werden sie von den privilegierten Kindern lediglich als oberflächlicher Zeitvertreib der guten Gesellschaft wegen ausgeübt, sind sie für das spätere Studium wenig rentabel. Erst wenn eine intensive rationale Auseinandersetzung mit der gebotenen Kultur stattfindet, können sich die kulturellen Privilegien in vollem Maße begünstigend auf den Studienerfolg auswirken.
3.4. Unterrichtsinhalt
Nach Auffassung der Autoren setzt jede Form von Unterricht, insbesondere in den Bildungsfächern, gewisse implizite Grundkenntnisse, Techniken und Ausdrucksmöglichkeiten voraus, die in der Regel aus den gebildeten Klassen stammen. Die humanistische Schulbildung vermittelt diesbezüglich jedoch nur ein Wissen zweiten Grades, das auf einen Schatz von Erfahrungen erstes Grades aufbaut - wie eben durch Theaterbesuche, freiwillige Lektüre, kulturelle Wallfahrten - und somit das nicht ersetzen kann, was Kindern minderprivilegierten Klassen aufgrund ihrer sozialen Stellung, wie bereits erläutert, nicht ohne weiteres offen steht. Da ihnen folglich die unmittelbaren Vorerfahrungen fehlen, auf die das zu lernende Wissen aufbaut, erscheinen Schülern und Schülerinnen aus unterprivilegierten Klassen die Unterrichtsinhalte weitaus schwerer nachvollziehbar, und der Unterricht wird eher als "dem Lehrer nach dem Munde reden" empfunden.
Nach Auffassung der Autoren ließe sich dieser Nachteil auch nicht dadurch beheben, dass man allen Klassen die gleichen wirtschaftlichen Mittel bereitstelle. Vielmehr liegt das Problem darin, dass sich Schüler und Schülerinnen aus den unteren Klassen Kenntnisse und Techniken aneignen müssen, die an bestimmte gesellschaftliche Wertvorstellungen der Oberschicht gekoppelt sind und die im Gegensatz zu ihrer eigenen Herkunftsklasse stehen. Schulbildung bedeutet aufgrund ihrer starken Orientierung an die Elitekultur insofern für die Kinder der Unterschicht immer zugleich auch Akkulturation. Was die gebildeten Kinder von zuhause aus mit auf den Weg bekommen -Stil, Geschmack und Lebensart - muss von den Kindern unterer Klassen mühsam erworben werden.
3.5. Aufstiegsbereitschaft
Aufgrund der vorhandenen empirischen Daten und mangelnder Vorbilder erscheint den unteren Klassen der berufliche, und damit verbunden soziale Aufstieg abstrakt und illusionär. Statistisch abgeschreckt, führt dies zu der absurden Situation, dass die Kinder unterer Klassen sich in der Tat gemäß ihren empirisch vermittelten Chancen verhalten. Bis vor kurzem fand auch keine Unterstützung eines vermeintlichen Lerneifers durch die Familie in den minderprivilegierten Klassen statt. In der Regel war es so nur Kindern mit außergewöhnlichen Fähigkeiten und außergewöhnlichem Familienmilieu aus der Arbeiterschicht möglich, auf die Universität vorzudringen.
Anders dagegen die Einstellung der mittleren Klassen: sie zollen der Elitekultur entsprechenden Respekt und sehen das Bildungswesen als Chance, kulturelles Prestige zu erwerben und gesellschaftlich aufzusteigen. Jedoch zeigt sich hier eine Diskrepanz zwischen kleinbürgerlichem Arbeitsethos und dem Dilettantismus der privilegierten Elite, die den Aufstieg kleinbürgerlicher Kinder wiederum bremst. Das ernsthaftig strebsame kleinbürgerliche Schulkind, das sich durch gewissenhafte und mühselige Arbeit nach oben kämpfen möchte, wird bereits schon von den Lehrern und Lehrerinnen in der Schule und später von den Dozierenden an der Universität nach den von der Elite geprägten Bildungskriterien beurteilt, und erscheint im Vergleich zum kultivierten Sohn oder der kultivierten Tochter aus gutem Hause, die ihr Wissen mit links erworben haben, als stur und spitzfindig.
4. Fazit
Die von den Autoren vorgelegte Analyse macht deutlich, dass die im ersten Abschnitt festgestellte Unterrepräsentation der minderprivilegierten Klassen an französischen Universitäten auf zahlreiche Faktoren zurückgehen, die an die soziale Klasse gebunden sind und sich insbesondere für Kinder minderprivilegierter Klassen als schwer zu überwindende Hürden aufweisen. Verantwortlich dafür ist nach Meinung der Autoren vor allem die Ausrichtung des Bildungssystems an die Elitekultur, die es Kinder bereits schon in der Schule schwer macht, sich in den nicht aus ihrer Klasse stammenden Bildungsinhalten zurechtzufinden, und sie somit bereits schon vorab in ihren Studienchancen einschränkt. Desweiteren sind Studierende minderprivilegierter Klassen, sofern sie es bis zur Universität schaffen, durch einen herkunftsbedingten Bildungsrückstand gekennzeichnet, der sich vor allem auf den Bereich der kulturellen Erfahrung erstreckt. Zudem bedeutet ein Studium für Minderprivilegierte - wie es die Autoren deutlich gemacht haben - immer auch gleichzeitig das Vordringen in eine Lebenskultur, mit der sie qua ihrer Herkunft nicht vertraut sind, die jedoch für Kinder aus privilegierten Klassen eine Selbstverständlichkeit darstellt.
Der Einfluss des kulturellen Erbes und der sozialen Herkunft ist nach Auffassung der Autoren so ausschlaggebend, dass er auch ohne ausdrückliche Diskriminierungsmaßnahmen wirksam ist. Die Autoren warnen deshalb, die durch die soziale Herkunft vorhandene Ungleichheit der Bildungschancen auf wirtschaftliche Ungleichheit oder mangelndem politischen Willen zurückzuführen und durch ein System von Stipendien- und Studienhilfe zu bekämpfen, da so eine Situation geschaffen würde, in der die bestehende Chancenungleichheit umso leichter auf mangelnde Begabung und mangelnden Bildungseifer zurückzuführen wäre.
Auffällig an der Pose der Autoren ist in diesem Zusammenhang, dass sich ihr Blickwinkel hauptsächlich nach oben richtet, also schwerpunktmäßig von der Chancenungleichheit unterer Schichten die Rede ist, jedoch nicht umgekehrt. Die Autoren diskutieren ausgiebig die Frage, warum Arbeiterkinder nur selten in elitäre Klassen vordringen, hinterfragen jedoch nicht, ob es für ein Kind aus Führungskadern nicht ebenfalls herkunftsbedingte Hürden gibt, sich z.B. für den Beruf des Landwirtes zu entscheiden. Daher stellt sich meines Erachtens die Frage, inwieweit diese Berufs- und Ausbildungspräferenzen nicht einfach nur das Abbild einer Fortsetzung von Familientradition sind, wo sich die Kinder freiwillig, weil naheliegend, für einen Beruf aus ihrem unmittelbaren Milieu entscheiden, und inwieweit man dann in den von Autoren behandelten Daten wirklich von einer Chancenungleichheit sprechen kann?
Desweiteren ist zu fragen, ob und inwieweit die Schule und das Ausbildungssystem eine Mitverantwortung an dieser "Chancenungleichheit" tragen oder ob es nicht vielmehr außer schulische Faktoren sind, die das Desinteresse der unteren Klassen am Studium bedingen und die durch das Bildungssystem nur widergespiegelt und nicht erzeugt werden.
5. Anhang
Institut für Soziologie
Proseminar zur Speziellen Soziologie: Organisati Wintersemester 1999/2000
Dozent: Dr. Ohlhaver
Referat:
Zur Illusion der Chancengleichheit I - Bildungsprivilegien und Bildungschancen
Literatur:
Pierre Bourdieu / Jean-Claude Passeron,Die Illusion der Chancengleichheit, Stuttgart 1971, S. 19-45.
Carsten Brettschneider Weißenburgstr. 46
24116 Kiel
0431-1490510 Kiel, den 01.12.1999
- Arbeit zitieren
- Carsten Brettschneider (Autor:in), 2000, Die Illusion der Chancengleichheit I, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100958
Kostenlos Autor werden
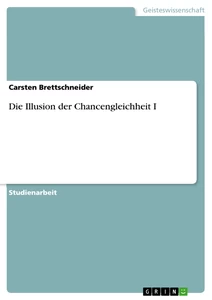
















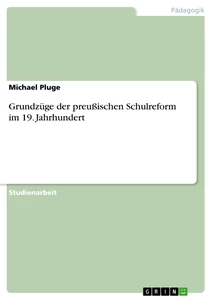

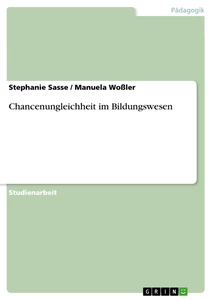
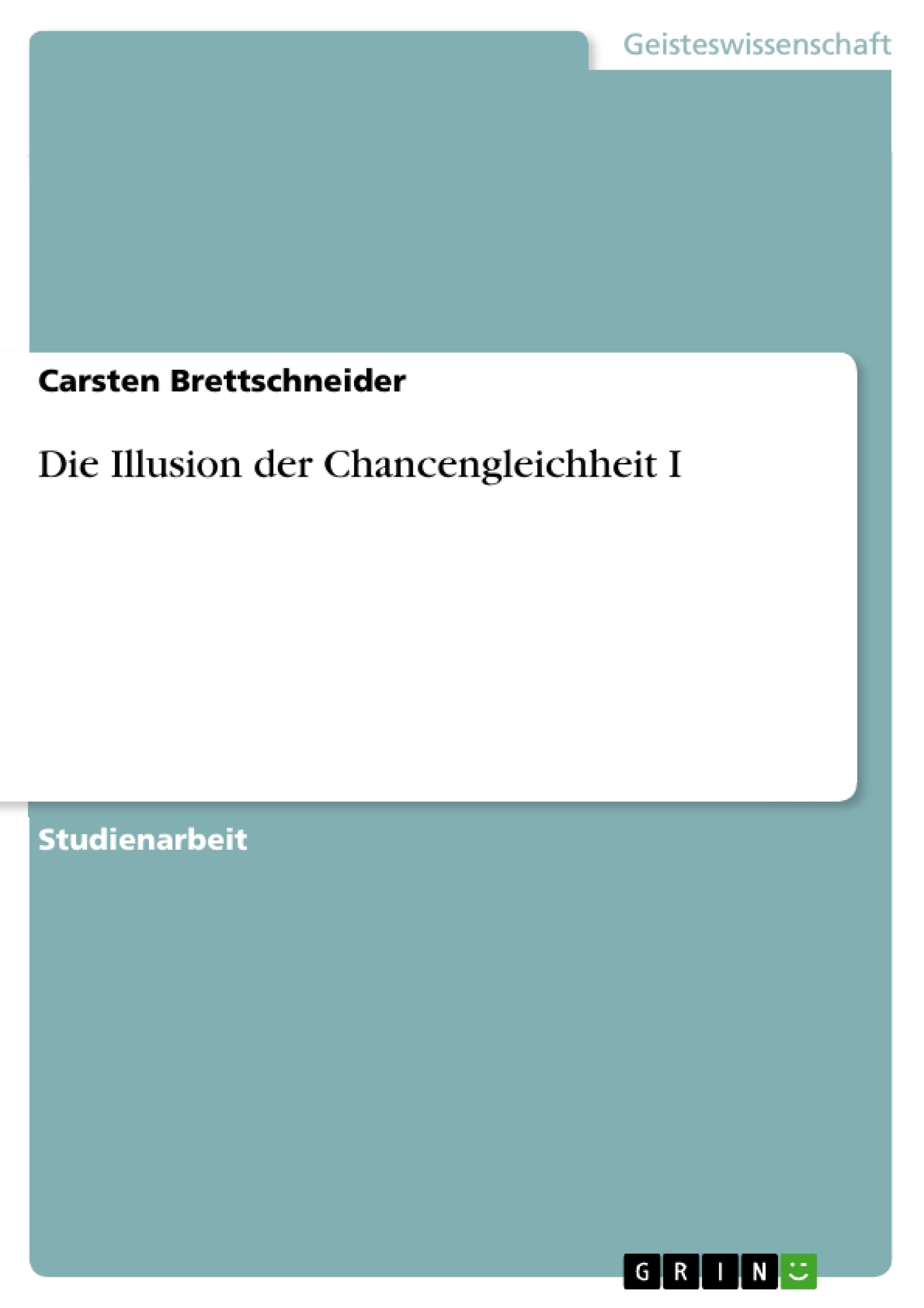

Kommentare